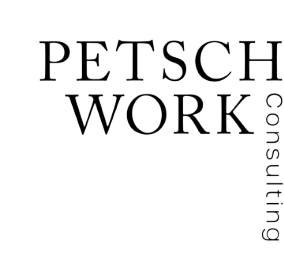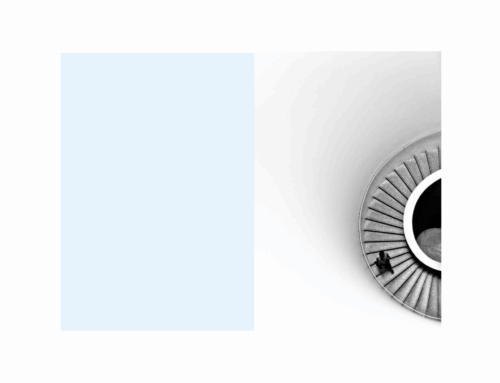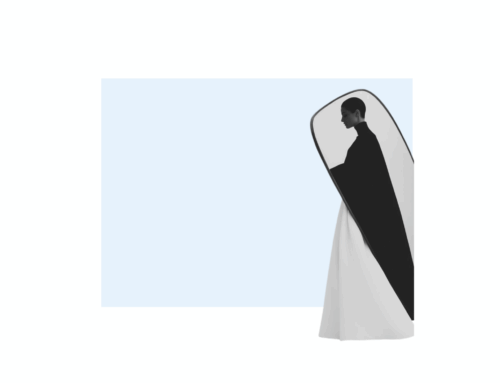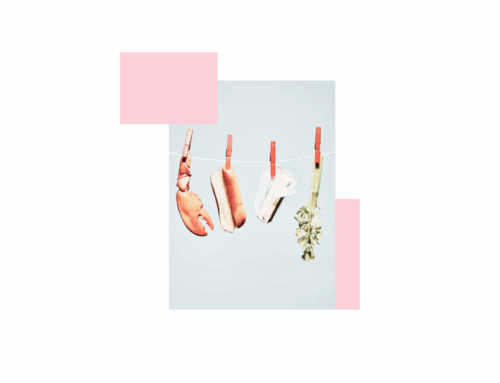Warum Sinn gute Arbeit zerstört
Es klingt paradox, aber manchmal erstickt das, was wir Sinn nennen, die Freiheit, gute Arbeit zu tun.
In vielen Unternehmen ist heute spürbar: Jede Tätigkeit, jede Entscheidung muss einem übergeordneten „Warum“ dienen. Wer diesen Anspruch nicht befriedigt, gerät ins Hintertreffen. Doch was passiert, wenn der Zwang nach Sinn stärker wird als das Tun selbst?
Der Druck, Sinn in allem zu finden
Wer permanent erklären, rechtfertigen und jede Handlung in ein großes Narrativ einfügen muss, verliert die Freude am Arbeiten. Aus intrinsischer Motivation wird das Bedürfnis, Bedeutung herzustellen. Der ständige Anspruch, jede Tätigkeit müsse zu etwas Größerem beitragen, schafft nicht Klarheit, sondern Unsicherheit.
Darin zeigt sich eine grundlegende Spannung, die auch in der Arbeitspsychologie diskutiert wird: Sinn kann als Zielvorgabe verstanden werden – etwas, das von Anfang an vorhanden sein muss – oder als Ergebnis, das sich erst aus dem Tun selbst ergibt.
Sinnsuche als Überforderung
Wenn jede Handlung in ein Narrativ gezwungen wird, geht Freiheit verloren. Statt Vertrauen ins Tun entsteht Dauerrechtfertigung, die Energie raubt.
Dabei sind Freiräume essenziell: Sie erlauben Experimente, Irrwege und Scheitern – oft das wertvollste Rohmaterial für Innovation. Forschungen zur Arbeitsmotivation zeigen, dass Menschen Handlungsspielräume brauchen, um sich entfalten zu können. Wird stattdessen jede Handlung permanent auf Sinn geprüft, erodiert das Vertrauen ins eigene Handeln.
Sinn als Ideologie – die Schattenseite
Wahre Arbeit entsteht nicht aus großen Narrativen, sondern aus Vertrauen in den Prozess. Doch sobald Sinn zum dauerhaften Erklärungsrahmen wird, kippt er in Ideologie. Kultur, Purpose und Leitbilder verlieren ihre Kraft, wenn sie nicht gelebt, sondern verordnet werden.
In der Organisationsforschung ist dieses Phänomen gut beschrieben: Wird Sinn zur normativen Vorgabe, gilt Abweichung nicht mehr als Ausdruck von Vielfalt, sondern als Fehler. Wer nicht ins vorgegebene Narrativ passt, wird schnell als unzureichend bewertet. Die Folge: Engagement und Zufriedenheit sinken, weil Menschen sich nicht mehr authentisch einbringen, sondern nur noch die Sinnvorgaben erfüllen. Ein bekanntes Beispiel dafür liefert das Konzept The Tyranny of a Team Ideology aus den Organization Studies, das zeigt, wie selbst gut gemeinte Sinn- und Gemeinschaftsideen kippen können, wenn sie zur Pflicht werden – Andersartigkeit wird nicht mehr geschätzt, sondern bestraft.
Warum Freiheit erstickt, wenn Sinn zu eng gedacht wird
Wenn das Streben nach Einfachheit, Klarheit und Funktionalität permanent einer überhöhten Sinnsuche untergeordnet wird, erdrückt das die Freiräume im Arbeitsprozess. Statt Freude am Tun entsteht das Gefühl, jede Handlung müsse über das Offensichtliche hinaus gerechtfertigt werden. Die unmittelbare Erfahrung – ein gelungenes Ergebnis, ein Moment der Konzentration – verliert an Wert, weil sie ständig hinterfragt wird.
Barbara Held beschreibt in What Makes Work Meaningful — Or Meaningless das Phänomen einer „tyranny of the positive attitude“. Der Druck, Arbeit ausschließlich unter dem Blickwinkel des Positiven und Bedeutenden zu betrachten, verhindert, auch die Schattenseiten anzuerkennen – Routine, Frustration, Ermüdung. Gerade diese Ambivalenzen machen Arbeit jedoch menschlich. Wenn wir nur das Gute und Bedeutungsvolle gelten lassen, verlieren wir das gesamte Spektrum des Erfahrbaren – und damit auch die Freiheit, Arbeit leicht, echt und widersprüchlich sein zu lassen.
Guter Unsinn statt falscher Sinn
Manchmal liegt die Antwort nicht in noch mehr Sinn, sondern im bewussten Raum für Un-Sinn. Gemeint ist nicht Beliebigkeit, sondern die Freiheit zu spielen, zu experimentieren und auch Umwege zu gehen. Gerade dort, wo Irrwege erlaubt sind, entstehen oft die besten Ideen. Un-Sinn ist kein Mangel, sondern ein Freiraum, in dem Kreativität wachsen kann.
Viele Organisationen setzen solche Räume bewusst ein – etwa durch „Innovation Days“, explorative Projekte oder flexible Gestaltungsoptionen im Jobdesign. Der Wert liegt darin, dass diese Freiräume nicht vom Anspruch nach ständiger Bedeutung erdrückt werden. Sie schützen davor, dass Sinn zur Pflicht wird – und eröffnen die Möglichkeit, dass Neues entstehen darf, ohne es rechtfertigen zu müssen.
Vom Ergebnis zur Bedeutung
Sinn entsteht nicht zwingend am Anfang, sondern häufig erst im Rückblick. Menschen finden Bedeutung in dem, was sie erschaffen, gestalten und bewirken – nicht in abstrakten Vorwegnahmen. Diese Perspektive verändert den Blick auf Arbeit grundlegend: Statt mit dem Anspruch zu starten, alles müsse von Beginn an einem höheren Zweck getragen sein, genügt es, mit Machbarkeit, Qualität und Klarheit zu beginnen. Der Sinn stellt sich oft dort ein, wo gute Arbeit getan wurde – als Folge, nicht als Vorbedingung.
Theoretische Verankerung: Sinnforschung & existentielle Psychologie
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Sinn zeigt, wie vielschichtig das Thema tatsächlich ist. Die Psychologin Tatjana Schnell beschreibt Sinnerfüllung anhand von vier Dimensionen: Kohärenz, Bedeutsamkeit, Orientierung und Zugehörigkeit. Entscheidend dabei: Sinn wird stabiler erlebt, wenn er aus mehreren Quellen gespeist wird – nicht allein aus der Arbeit.
Auch in Organisationen zeigt sich, dass Sinnfragen am wirksamsten in Reflexionsräumen bearbeitet werden, nicht in dogmatischen Vorgaben. Coaching kann hier eine Brücke sein: im Führungskontext, in Veränderungsprozessen oder beim Umgang mit Ambivalenzen. Es bietet die Möglichkeit, Sinn nicht zu verordnen, sondern zu erforschen.
Einen weiteren Akzent setzt der Wirtschaftspsychologe Ingo Hamm mit seinem Ansatz Sinnlos glücklich. Er zeigt, dass Erfüllung und Zufriedenheit im Beruf auch ohne überhöhten Purpose möglich sind – etwa dann, wenn Menschen Selbstwirksamkeit erfahren und in einen Flow-Zustand gelangen. Der Fokus liegt weniger auf großen Narrativen, sondern auf gelebter Erfahrung und Kompetenz im Alltag.
Praktische Implikationen für Unternehmen und Führung
Wie lässt sich diese Kritik in der Praxis umsetzen, ohne in Beliebigkeit zu verfallen?
• Sinn als Option, nicht als Norm
Unternehmen können Narrative anbieten, aber sie dürfen nicht verpflichten. Sinn darf nicht zur Pflicht werden.
• Raum für Unfertiges schaffen
Freiräume, Experimentierfelder, Prototyp-Projekte, bei denen Scheitern erlaubt ist.
• Führung als Sinnmoderation
Sinn nicht verkünden, sondern gemeinsam mit Mitarbeitenden explorieren – durch Coaching, Dialog, Feedbackkultur.
• Sinnerleben divers halten
Mitarbeitende sollten mehrere Sinnquellen haben: Team, Werte, Aufgaben, Impact. Nicht alles darf an der Unternehmensmission hängen.
• Reflexion statt Rechtfertigung
Die Frage „Warum mache ich das?“ darf erlaubt sein, aber nicht erzwungen. Besser: „Was hat diese Arbeit bewirkt?“ – zurückblickend, nicht voraus.
Fazit: Der richtige Umgang mit Sinn
Sinn ist eine kostbare Ressource – wenn er nicht zum Dogma wird. Der Druck, ständig Bedeutung zu erzeugen, führt in Sackgassen: zur Überforderung, zur Entfremdung vom Tun und zur Erosion der Motivation.
Der Schlüssel liegt nicht im Eliminieren von Sinn, sondern im achtsamen Umgang mit ihm: Narrative als Orientierung, nicht als Gesetz. Freiräume als Ermöglichung, nicht als Widerspruch. Und im Vertrauen, dass guter Sinn oft erst im Rückblick entsteht.
Quellen
- Ingo Hamm: Sinnlos glücklich. Warum Purpose uns nicht weiterbringt. 2022
- Tatjana Schnell: Psychologie des Lebenssinns. 2016
- MIT Sloan Management Review: What Makes Work Meaningful — Or Meaningless (2017)
- Westwood, R., & Johnston, A.: The Tyranny of a Team Ideology (Organization Studies, 2012)
- Coaching-Magazin: Orientierung und Sinn in dynamischen Unternehmensumwelten (2019)